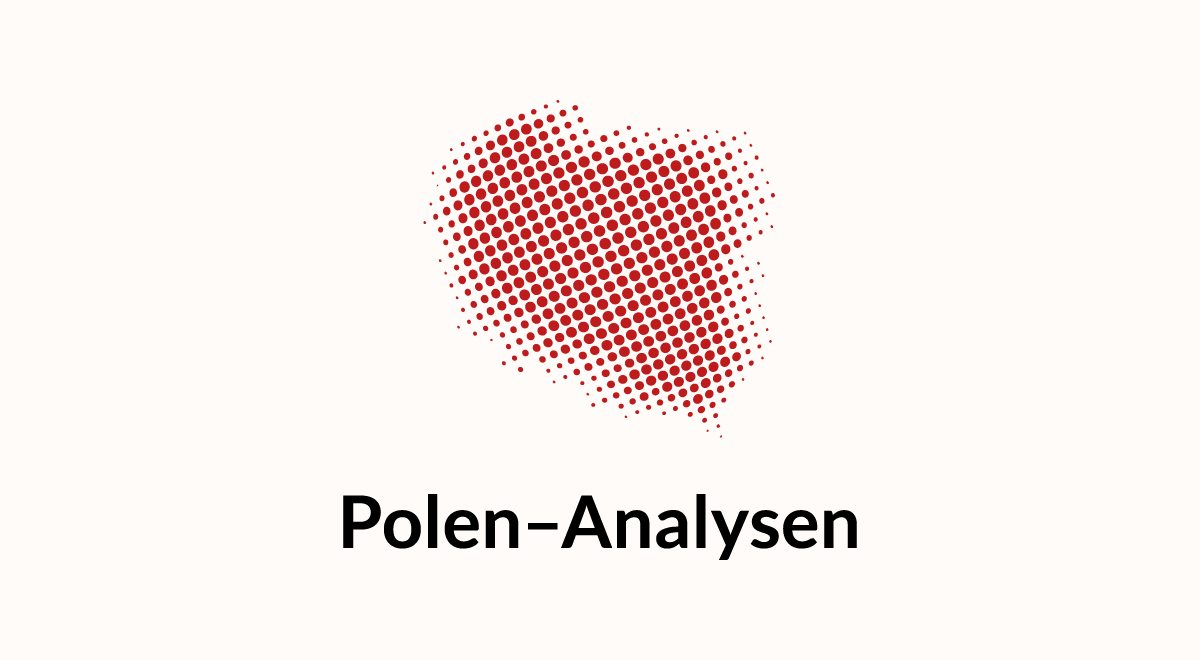 Analyse
Analyse Von Krzysztof Ruchniewicz
Der Autor skizziert die Entstehungsgeschichte des polnisch-deutschen Schulbuchprojekts, das an die Arbeit der polnisch-deutschen Schulbuchkommission anknüpft, die 1972 gegründet worden war. Mit zunehmender Entkrampfung in den polnisch-deutschen Beziehungen und der Entwicklung des polnisch-deutschen Schüleraustauschs seit den 1990er Jahren stieg der Bedarf, neues Lehrmaterial zu entwickeln und zu veröffentlichen. Die vom damaligen deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier vorgestellte Idee, ein gemeinsames deutsch-polnisches Lehrbuch zu verfassen, stieß bei der national-konservativen Regierung in Warschau auf kein Interesse; nach dem Regierungswechsel in Warschau 2007 gab die große Politik grünes Licht. Mittlerweile sind die Empfehlungen für das polnisch-deutsche Geschichtsbuch von Experten erarbeitet und der Öffentlichkeit im Dezember 2010 vorgestellt worden. Nun entscheidet sich am freien Markt, ob sich ein polnisch-deutsches Verleger-Tandem findet, das es übernimmt, die ersten Bände von Geschichtsdidaktikern entwickeln zu lassen und herauszugeben. (…)
Zum Artikel 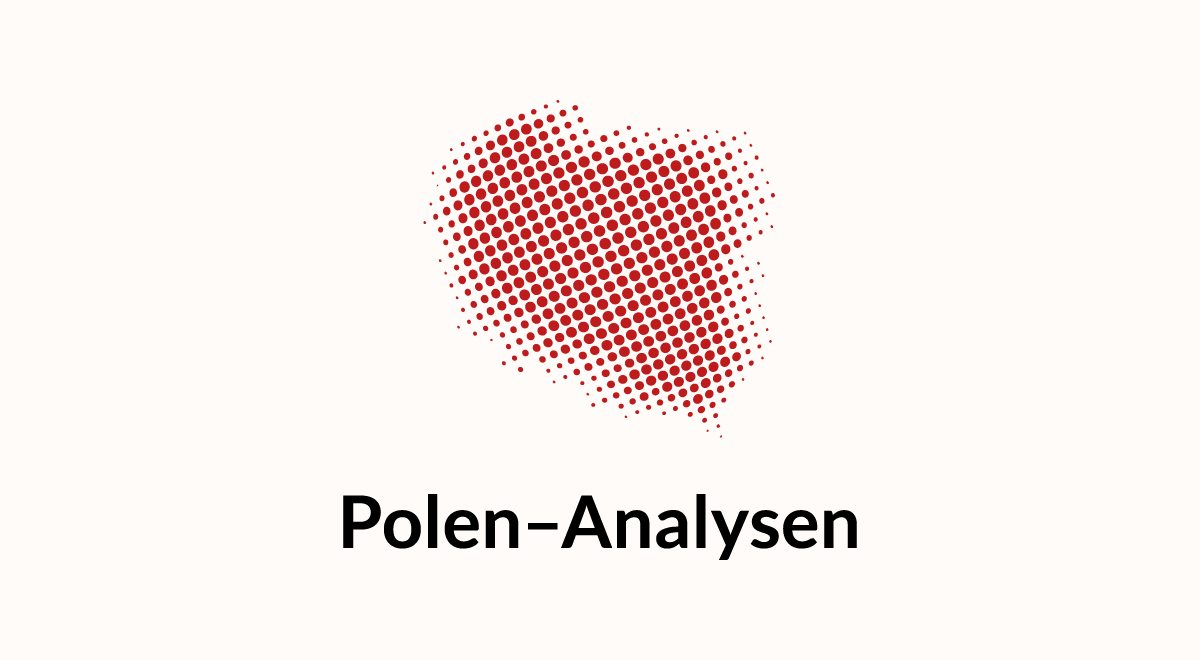 Analyse
Analyse Von Andrzej Kaluza
Der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag von 1991 sichert Angehörigen der deutschen Minderheit in Polen und Angehörigen der Gruppe deutscher Staatsbürger mit polnischer Abstammung oder Bekenntnis zur polnischen Sprache, Kultur oder Tradition vergleichbare Rechte zu. Die etwa 300.000 polnischen Staatsbürger, die sich als Deutsche verstehen, werden nicht nur durch den bilateralen Vertrag, sondern auch durch den polnischen Gesetzgeber als Minderheit anerkannt und genießen dadurch bestimmte Förderrechte (Bildung, Kultur, Medien) von Seiten des Staates. Dagegen hat die polnischsprachige Gruppe in Deutschland formalrechtlich nicht den Status einer nationalen Minderheit, da sie nicht zu den traditionellen in Deutschland ansässigen Minderheiten zählt, sondern aus Migranten besteht. Vertreter der »Polonia«-Organisationen in Deutschland streben diesen Status dennoch an. Der Autor weist darauf hin, dass sowohl die historischen Argumente wie auch die Ausdifferenzierung der Selbstidentifikation der Angehörigen der polnischen Gruppe in Deutschland den Status einer nationalen Minderheit nicht begründen können, gleichwohl aus dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag einzulösende Verpflichtungen (z. (…)
Zum Artikel